|
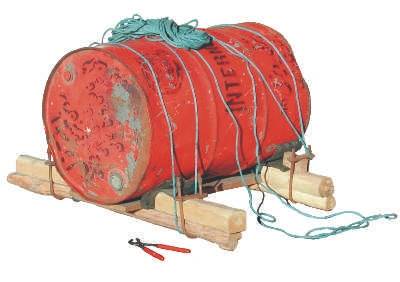
oil of gladness
|
|
|
|
|
|
 Ribaa
Ribaa
 Wirtschaft
Wirtschaft
404
Als das
Geld vom Himmel fiel
1,5 Billionen Euro haben die
Zentralbanken seit der Finanzkrise erschaffen. Sie gaben sie
den Banken, die damit der Wirtschaft wieder auf die Beine
helfen sollten. Doch bei Autoherstellern und Maschinenbauern
ist das Geld nie angekommen. Wo ist es geblieben?
Von
Kerstin Kohlenberg |
Mark Schieritz |
Wolfgang Uchatius
Datum
19.1.2010 - 08:28 Uhr © Rainer Hosch
http://www.zeit.de/2010/03/DOS-Wo-das-Geld-geblieben-ist?page=all&print=true [Bilder
nicht im Original; eingeblendet] Mitarbeit: Kristina
Maroldt und
Frank
Sieren
Floss das Geld in den Rohstoffhandel?
70 Prozent hat das Geschäft des New Yorker Ölhändlers
Raymond Carbone in den vergangenen zehn Monaten zugelegt.
Als Herr S. am 24. Juni 2009 in sein Büro kommt, hat er
eine Aufgabe mit acht Nullen. Er soll innerhalb weniger
Stunden mehrere Hundert Millionen Euro auftreiben. Was die
meisten Bundesbürger in Panik versetzen würde, ist für S.
eine einfache Transaktion. Denn erstens arbeitet er für eine
gross
e deutsche Bank in Frankfurt. Und zweitens ist gerade
Finanzkrise.
Und nichts ist in dieser Krise so leicht zu bekommen wie
Geld.
S. ist ein wichtiger Mann in seiner Bank, obwohl er erst
Anfang vierzig ist. Der Konzern hat weltweit mehrere
Zehntausend Mitarbeiter. Nur etwa ein Dutzend Leute steht in
der Hierarchie über S. Man merkt ihm die Bedeutung an. S.
ist keiner dieser Banker, die es nötig haben, dauernd von
irgendwelchen Deals zu sprechen. Er spricht lieber einen
gemütlichen Dialekt, er kann sich das leisten. S. ist der
oberste Geldeintreiber seiner Bank.
Ein Autohersteller benötigt Blech, Reifen, Türgriffe, um
daraus Autos zu bauen. Eine Bank benötigt Geld, um daraus
mehr Geld zu machen. Ohne S. wäre die Bank wie ein
Autokonzern, dessen Bänder stillstehen.
Und weil Banken nicht gerne darüber reden, woher sie ihr
Geld bekommen, darf man nicht sagen, bei welcher Bank Herr
S. arbeitet.
An diesem Morgen des 24. Juni 2009 tippt S. wieder einmal
seinen Nutzernamen und sein Passwort in den Computer. Dann
ist er drin im elektronischen System der Europäischen
Zentralbank. S. gibt den gewünschten Geldbetrag ein, mehrere
Hundert Millionen Euro, und lehnt sich zurück.
Um 11.42 Uhr bekommt er die Nachricht: Das Geld ist
unterwegs. Nicht nur zu S. und seiner Bank, sondern auch zu
1120 anderen gross
en und kleinen europäischen Banken. Sie
alle machen Gebrauch vom Angebot der Europäischen
Zentralbank (EZB), sich an diesem Tag unbegrenzt und fast
zum Nulltarif Geld zu leihen: 442 Milliarden Euro erhalten
sie. Das entspricht 80 Prozent der jährlichen
Steuereinnahmen des deutschen Staates.
Das Geld ist Teil der ungewöhnlichsten Rettungsaktion der
Geschichte. Kein Mensch ist wiederzubeleben, sondern ein
System: der Kapitalismus.
Um Geld zu drucken, braucht man keine
ratternden Maschinen mehr
Als nach der Pleite der amerikanischen Investmentbank
Lehman Brothers am 15. September 2008 die Weltwirtschaft vor
dem Zusammenbruch stand, rückten Institutionen in den
Blickpunkt, deren Existenz in guten Zeiten kaum jemand
bemerkt hatte: die EZB, die amerikanische Federal Reserve,
die Bank von Japan – die staatlichen Zentralbanken. Wie
Mediziner an einen Unfallort wurden ihre Präsidenten an das
Krankenbett der Marktwirtschaft gerufen. Alle propagierten
dieselbe Therapie: Man müsse dem zusammengebrochenen System
neues Geld injizieren. So wie ein Notarzt elektrischen Strom
in ein lebloses Herz jagt.
1,5 Billionen Euro haben die gross
en Zentralbanken seit
Beginn der Finanzkrise den privaten Banken als Nothilfe
geliehen. Jetzt, 480 Tage später, wirft das eine simple
Frage auf.
Was ist mit dem Geld passiert?
Hat das Geld neue Arbeitsplätze geschaffen? Hat es
ruinierte Privatanleger gerettet? Wem hat es geholfen?
Und woher haben die Zentralbanken das Geld überhaupt
genommen? Haben sie es sich von den Steuerzahlern geliehen?
Von ausländischen Investoren? Oder hatten sie die anderthalb
Billionen im Tresor liegen?
Die Suche nach dem Geld wird in die bayerische Provinz
führen, in ein afrikanisches Bergwerk, ein chinesisches
Luxusrestaurant und zu einem amerikanischen Börsenhändler.
Ganz am Ende wird man an einen Mann geraten, dessen Beruf es
ist, Schulden zu machen – im Auftrag der Bundesrepublik
Deutschland.
Ganz am Anfang jedoch gilt es herauszufinden, woher das
Geld stammt, das den Kapitalismus zu neuem Leben erwecken
sollte. Man muss sich noch einmal an jenem 24. Juni 2009 zu
Herrn S. in die Bank begeben, oder genauer: an den Ort, von
dem er sich das Geld holte, an den Sitz der Europäischen
Zentralbank, in den Eurotower, einen dieser typischen
Frankfurter Glaskästen.
150 Meter ist er hoch, von oben sieht man die ganze Stadt
und dahinter die Hügel des Taunus. Dort, wo das Geld
herkommt, sieht man die Hauswand von gegenüber, sonst
nichts. Ein Grossraumbüro im ersten Stock. Zwischen
Kinderfotos und Stofftieren sitzen zwei junge Männer und
beobachten die Namen, die auf ihren Bildschirmen auftauchen:
die Westdeutsche Landesbank, die Hypo Real Estate, die
griechische Bank Emporiki. Es sind die Banken, die sich Geld
leihen wollen.
Um kurz nach halb zehn drückt einer der beiden Männer
einen Knopf, und etwa zwanzig Seiten Papier schieben sich
aus dem Drucker. Das Protokoll für das Präsidium der
Zentralbank. Das Dokument einer wundersamen Geldentstehung.
Die 442 Milliarden, die an diesem Tag von der Zentralbank
zu den Privatbanken fliess
en, haben zuvor nicht der EZB
gehört. Nicht dem Steuerzahler. Und auch sonst niemand. Das
Geld ist gewissermassen vom Himmel gefallen.
Die Zentralbank hat es am Vormittag dieses 24. Juni neu
erschaffen. Sie braucht dafür keine ratternden
Druckmaschinen mehr, es genügt, den gewünschten Betrag auf
das Konto zu überweisen, das jede Bank der Eurozone bei der
EZB unterhält. Zwölf Monate lang dürfen die Banken das Geld
behalten. Dann müssen sie es an die Zentralbank
zurückzahlen, und die Konten leeren sich wieder.
Zwölf Monate, in denen die Banken mit diesem Geld
arbeiten sollen. Zwölf Monate, in denen dieses Geld den
Kapitalismus reanimieren muss.
Das Herz des Kapitalismus soll wieder
zu schlagen beginnen
Am Nachmittag des 24. Juni beantwortet der italienische
EZB-Direktor Lorenzo Bini Smaghi an der Universität Rom die
Fragen von Journalisten. Einer will wissen, wie Bini Smaghi
den gross
en Geldverleih dieses Morgens einschätze. Bini
Smaghi sagt, die Banken müssten das Geld weiterreichen an
die Realwirtschaft. Kredite vergeben. Davon hänge der Erfolg
der Massnahme ab.
Die Realwirtschaft: Das sind Unternehmen, die Autos
produzieren, Waschmaschinen, Kleiderschränke. Dinge, die man
anfassen kann. Wenn die Banken ihnen Kredite gewähren,
verwandelt sich das neue Geld in neue Produkte, in
Arbeitsplätze. In Wohlstand. Das Herz des Kapitalismus
beginnt wieder zu schlagen. Das ist das Kalkül der
Zentralbanken.
Folglich müsste das neue Geld allein in Deutschland an
Tausenden Orten zu finden sein. Bei Automobilkonzernen,
Softwareherstellern oder mittelständischen Maschinenbauern.
Überall, wo Unternehmen neues Kapital brauchen, um Mehrwert
zu schaffen, müsste man auf das Geld stossen. Zum Beispiel
bei diesen russverschmierten Männern, die da in einer alten
Fabrikhalle in Kitzingen in Unterfranken flüssiges Eisen in
Gussformen kippen.
Sie tragen Helme und schwere Schuhe. Das Eisen holen sie
aus Öfen, die so gross
sind wie die Kessel von
Dampflokomotiven und so heiss, dass die Halle auch im Winter
keine Heizung braucht. Aber Ohrstöpsel, die braucht man. Zu
Hunderten liegen sie in Plexiglaskästen, die aussehen wie
Kaugummiautomaten. Ein kleiner Schutz gegen das Kreischen
des Metalls, das Stampfen der Pressluft, gegen all den
schmerzenden Lärm, der in Wahrheit ein guter, ein
gewinnbringender Lärm ist. Je mehr Lärm, desto mehr Umsatz
macht die Fabrik. Denn in dem Getöse entstehen gusseiserne
Schwungräder, Lenkgehäuse, Kurbelwellen, die irgendwann
unter der Karosserie eines Audi A6, eines VW Passat oder
einer Mercedes-M-Klasse verborgen sein werden.
Längst produzieren Volkswagen und Daimler einen Teil
ihrer Autos in Ländern wie Mexiko oder China, wo die Löhne
niedrig sind und die Menschen noch nicht so viele Autos
haben wie in Deutschland. Die Schwungräder und Stossdämpfer
aber holen sie per Lastwagen und Containerschiff aus der
nordbayerischen Provinz. Weil es in Asien und Lateinamerika
keine Fabrik gibt, die so gut arbeitet wie die Firma Franken
Guss in Kitzingen.
Man könnte dieses Unternehmen also für sehr erfolgreich
halten, hätte es nicht vor Kurzem noch MTK-Giesserei
geheissen. Hätten hier nicht 790 Leute gearbeitet. Heute sind
es bloss noch 420. Und die sind nur deswegen da, weil der
Geschäftsführer die bankrotte Firma kurzerhand selbst
gekauft und umbenannt hat, als die beiden Hausbanken, die
HypoVereinsbank und die Commerzbank, dem Unternehmen den
Kredit verweigerten, der nötig gewesen wäre, die Finanzkrise
zu überstehen. Der Insolvenzverwalter sagte damals, er habe
nie zuvor ein so gesundes Unternehmen pleitegehen sehen.
An Kitzingen in Unterfranken ist das Geld der
Europäischen Zentralbank vorbeigeflossen. Genau wie an
Tausenden anderen deutschen Unternehmen. Das Münchner ifo
Institut für Wirtschaftsforschung, der Bund der
Deutschen Industrie, der Zentralverband Elektrotechnik und
Elektronikindustrie, sie alle haben in den vergangenen
Monaten deutsche Firmen befragt. Immer gaben sie dieselbe
Antwort: dass sie Schwierigkeiten haben, an Geld zu kommen,
an Kredite, die sie in der Krise so dringend brauchen.
Aber irgendwo müssen die Billionen der Zentralbanken
doch sein. Nur wo?
Raymond Carbone trägt eine graugrüne Trekkinghose und
bequeme Schuhe. Er ist ein muskulöser Mann mit kahlem Kopf.
Carbone ist 50 Jahre alt, aber noch immer fällt es ihm
schwer, sich Ruuhhig zu halten. Er erinnert an einen
erfahrenen Boxer, der nicht aufhören will zu kämpfen. Sein
Ring steht am unteren Rand von Manhattan, in der Nymex, der
gröss
ten Warenterminbörse der Welt. Raymond Carbone ist
dort Ölhändler, aber wenn er die Börse betritt, heisst er
nicht mehr Raymond Carbone. Er heisst dann »Vox«. Die Stimme.
Alle Ölhändler tragen solche Kampfnamen, sie sind
leichter auszusprechen als die tatsächlichen Vor- oder
Nachnamen. Das spart Zeit. Und genau Daarum geht es Carbone:
Er muss schnell sein, schneller als die 120 anderen
Ölhändler. Dummerweise stehen sie alle um ihn herum.
Carbone brüllt. Er schiebt, rempelt, drückt. In der einen
Hand hält er ein Telefon, durch das ihm seine Kunden ihre
Aufträge ins Ohr rufen. Die andere Hand schwenkt er durch
die Luft, hebt und senkt einzelne Finger, signalisiert, dass
er Ölkontrakte kaufen oder verkaufen will. Für jede Summe,
jeden Kaufmonat, jede Order gibt es ein Handzeichen. Carbone
spricht in der Gebärdensprache der Finanzwelt.
Alle paar Minuten löst er sich aus der Masse der Gegner
und läuft hinüber zu seinem Computerterminal am Rand des
Börsensaals. Sechs kleine Fenster haben sich auf dem
Bildschirm geöffnet. Sechs Nachrichten von Kunden. Sechs
Aufträge, Anfragen, Bitten um Information.
Hinter jedem der kleinen Fenster verbirgt sich irgendwo
auf der Welt ein Investmentbanker, Hedgefonds-Manager,
Finanzinvestor. Die einen in London, in Zürich oder
Hongkong, die anderen gleich nebenan in New York. Und alle
wollen sie Öl kaufen. Denn alle haben sie viel Geld
anzulegen. Neues Geld, das vom Himmel fiel, als die
Zentralbanken es den Privatbanken liehen. Altes Geld, das
die Krise überlebt hat und bisher auf irgendeinem Konto lag.
Dort vermehrt es sich nicht mehr, seit die Zentralbanken
ihre Milliarden fast gratis verleihen und die Zinsen überall
sinken. Also fliesst es zu Leuten, die höhere Renditen
versprechen. Zu Leuten wie Raymond Carbone.
In den vergangenen zehn Monaten sind seine Umsätze um 70
Prozent gestiegen. Genau wie die der meisten anderen
Börsenhändler. Es ist ein erstaunlicher Boxkampf, der da
täglich an der Warenterminbörse Nymex stattfindet.
Einer, in dem es kaum Verlierer gibt.
Auf den Bildschirmen der Börsenhändler flimmern Zahlen,
man sieht gezackte Linien, die nach oben oder unten führen,
je nachdem ob die Preise von Öl, Gold, Blei oder Aluminium
steigen oder fallen. Im Moment steigen sie alle.
Kein wichtiger Rohstoff ist so stark
im Wert gestiegen wie Kupfer Die Banken und Investmentfonds
dieser Welt kaufen seit Monaten Öl, obwohl sie kein Benzin
produzieren. Aber der Ölpreis ist heute fast doppelt so hoch
wie vor einem Jahr. Sie kaufen Gold, obwohl sie keinen
Schmuck herstellen. Aber der Goldpreis ist um 30 Prozent
gestiegen. Sie kaufen sogar Zucker und gefrorenes
Orangensaftkonzentrat, obwohl sie keine Limonade
machen. Aber der Zuckerpreis ist um 130 Prozent gestiegen
und der Preis für Orangensaftkonzentrat um 80 Prozent.
Die Banken und Investmentfonds kaufen einen Rohstoff,
weil sie glauben, dass sein Preis weiter steigt und sie ihn
in ein paar Monaten mit Gewinn verkaufen können. Genauso wie
sie brasilianische und chinesische Immobilien kaufen und
indonesische und russische Aktien. Sie kaufen all das, weil
sie Geld übrig haben. Viel Geld.
1,5 Billionen Euro hatten die Zentralbanken erschaffen,
in Amerika, Europa, Japan. Doch kaum ein Unternehmen hat
dadurch einen neuen Bankkredit erhalten, kaum eine Firma
konnte deswegen neue Arbeitsplätze schaffen, kaum ein
Betrieb schaffte es, deshalb wichtige Aufträge zu erlangen.
Im Gegenteil. Die Banken haben in den vergangenen Monaten
weniger Kredite vergeben. Manche Finanzhäuser haben das
billig geliehene Geld in Wertpapieren angelegt. Andere
scheuten selbst dieses Risiko und liess
en es auf ihren Konten
bei der Zentralbank liegen.
So kommt es, dass sich das neue Geld nicht in neue
Produkte verwandelte, wie EZB-Direktor Lorenzo Bini Smaghi
hoffte. Sondern in höhere Preise. Das Geld der
Zentralbanken hat dazu geführt, dass Rohstoffe, Aktien und
Immobilien teurer wurden. Es ist jenen zugutegekommen, denen
die Aktien und die Häuser gehören. Es hat die Gewinne derer
erhöht, die das Öl produzieren. Das Gold. Den Zucker. Den
Orangensaft. Und das Kupfer.
Kein anderer wichtiger Rohstoff hat sich in den
vergangenen zehn Monaten so sehr verteuert wie Kupfer. Um
fast 150 Prozent ist der Preis gestiegen. Und mit ihm
wuchsen die Gewinne der Bergbauunternehmen.
Jeden Tag um Punkt halb fünf fliegt alles in die Luft.
Quarzquader, Erzbrocken, Schiefersplitter, jahrtausendelang
unter Sand und Stein verborgen, werden ans Tageslicht
geschleudert, rollen krachend den Felshang hinunter, wirbeln
roten Staub auf. Nachmittags ist Sprengzeit in der
Kansanshi-Mine in Nordwest-Sambia. Ein Schatz will geborgen
werden. Mit der Stille nach dem Knall kommen die Bagger. Am
Grund eines 160 Meter tiefen, zwei Kilometer breiten Kraters
wühlen sie sich durch das Geröll. Jede Sprengung gibt ihnen
neues Futter, legt ein weiteres Stück jenes Erzes frei, das
sich in diesem Teil Afrikas als grünes und weiss
es
Aderngeflecht nahe der Erdoberfläche durch den Kalkstein
zieht: Kupfer.
Kein Computer, kein Handy, kein Kühlschrank funktioniert
ohne dieses Metall. Durch kaum einen anderen Stoff fliesst
Strom so leicht und schnell hindurch. Einer der Männer, die
es aus der Erde holen, ist Prosper Nkausu.Er ist ein
hochgewachsener, schmaler Mann von 39 Jahren, Vater von
sechs Kindern. Sie zu ernähren ist nicht einfach in einem
Land wie Sambia, in dem acht von zehn Menschen mit
umgerechnet weniger als zwei Dollar am Tag auskommen müssen.
Vor sechs Jahren machte er sich auf den Weg in den Westen
des sogenannten Kupfergürtels, in eine damals verschlafene
Kleinstadt an der Grenze zum Kongo, in der heute 500.000
Menschen leben. »Geh nach Solwezi«, hatte ihm jemand gesagt,
»da bauen sie eine neue Mine.«
Prosper Nkausu hat Glück gehabt, einerseits. Seine
Familie lebt in einem kleinen Haus mit Wellblechdach, nicht
in einer Lehmhütte. Das Wasser kommt aus der Leitung, nicht
aus einem modrigen Brunnen, und die Kinder gehen in eine
ordentliche Schule. Aber es ist ein altes Glück. Eines, das
sich nicht vergröss
ert hat in den vergangenen Monaten, als
der Kupferpreis immer stärker stieg und die Mine so viel
Geld einnahm wie noch nie.
Geschützt von Helm, Overall und Gummistiefeln, beugt sich
Prosper Nkausu noch immer in Zwölfstundenschichten über
ein riesiges Becken mit Schwefelsäure, in dem winzige
Kupferpartikel schwimmen. Die Partikel lagern sich in dicken
Schichten an Metallplatten ab, und Nkausu schneidet sie
herunter. Noch immer atmet er den Dunst der Säure. Noch
immer bringt er seiner achtköpfigen Familie umgerechnet 14
Euro am Tag nach Hause. Noch immer züchtet er nebenbei
Hühner und baut Bohnen im Garten an, um seinen Lohn
aufzubessern.
Wo also ist der neue Reichtum der Mine geblieben? Wo
sind die 150 Prozent?
Wenn Prosper Nkausu morgens in einem Sammeltaxi über
Schotterpisten zur Mine fährt, kann er ihn manchmal sehen,
den Reichtum. Er braust in Form von modernen Geländewagen an
ihm vorbei. Meist sind es Amerikaner, Briten oder Kanadier,
die am Steuer sitzen. Mal wollen sie zur Mine, mal sind sie
auf dem Weg zum Golfklub oder auch nur nach Hause, in eine
der Villen, die ein langer Zaun von der übrigen Stadt
trennt. Sie sind Ingenieure und Manager des kanadischen
Bergbauunternehmens First Quantum Minerals, des Eigentümers
der Kansanshi-Mine.
First Quantum ist ein junges, noch nicht sehr gross
es
Unternehmen, aber es wächst schnell in diesen Monaten. Wenn
man ein Unternehmen sucht, dem das Geld der Zentralbanken zu
guten Geschäften verholfen hat, so ist dies eines davon. Von
Januar bis September 2009 hat sich der Aktienkurs der Firma
mehr als verfünffacht. First Quantum verzeichnete einen
Gewinn von umgerechnet 164 Millionen Euro.
Das Geld sickert nicht nach unten, es
fliesst zu den Banken zurück
Ein kleiner Teil des Geldes bleibt in Solwezi, wird
verwandt, um bessere Strassen und Stromleitungen zu bauen,
führt dazu, dass weitere Hotels, Banken und Supermärkte
entstehen. Das meiste aber fliesst ab, in ein Bürohaus in der
kanadischen Stadt Vancouver, in der Nähe des Hafens, wo
First Quantum Minerals seinen Sitz hat. Dort bleibt es,
zuerst, und bewegt sich dann weiter, um die halbe Welt,
verteilt sich als Dividende auf die Besitzer der 80
Millionen Aktien, die das Unternehmen ausgegeben hat. Manche
dieser Aktien sind Eigentum von Privatleuten. Viele andere
aber gehören Investmentfonds und Banken.
Das Geld sickert nicht nach unten. Es fliesst zurück zu
den Finanzhäusern, von denen es gekommen ist.
New York, 16. Oktober 2009: Die amerikanische
Investmentbank Goldman Sachs gibt für die Monate Juli bis
September einen Gewinn von 3,2 Milliarden Dollar bekannt,
viermal mehr als im Jahr zuvor.
Tokyo, 29. Oktober 2009: Das gröss
te japanische
Wertpapierhaus Nomura, das Teile der Pleitebank Lehman
übernommen hatte, schreibt nach fünf verlustreichen
Quartalen wieder schwarze Zahlen.
London, 11. November 2009: Die britische Grossbank
Barclays verkündet, ihr Gewinn habe sich im dritten Quartal
2009 im Vergleich zum Vorjahr auf 4,4 Milliarden Pfund
verdoppelt.
Frankfurt, 15. Dezember 2009: Die Deutsche Bank stellt
ihren Aktionären für das Jahr 2011 einen Rekordgewinn von
zehn Milliarden Euro in Aussicht. Zwei Drittel davon sollen
aus dem Investmentbanking kommen.
Vier Nachrichten, die gut zu einer fünften passen, die
sich zur selben Zeit verbreitete: Es gibt in den
Bankentürmen wieder hohe Boni zu kassieren. Die
amerikanische Investmentbank Morgan Stanley will ihre
Angestellten für das Jahr 2009 mit insgesamt 11,9 Milliarden
Dollar prämieren, Goldman Sachs sogar mit 20 Milliarden.
Nach Berechnungen der amerikanischen Zeitung Wall Street
Journal zahlen allein die 23 gröss
ten amerikanischen
Banken ihren Mitarbeitern in diesem Jahr Gehälter in Höhe
von 95 Milliarden Dollar. Das sind zehn Milliarden Dollar
mehr als im bisherigen Rekordjahr 2007 und über 20
Milliarden Dollar mehr als im Krisenjahr 2008.
Es ist wieder viel Betrieb an den abendlichen
Treffpunkten der Investmentbanker in den Geschäftsvierteln
dieser Welt, in den Bars und Restaurants in London,
Frankfurt, New York. Oder in Hongkong. Eines der teuersten
Restaurants dort ist das Wagyu in einer der alten, mondänen
Strassen aus der Kolonialzeit.
Die Fensterscheiben reichen bis zum Boden, dahinter liegt
ein in Brauntönen gehaltenes Terrarium der Reichen. Es ist
Freitagabend, Viertel nach zehn, die Männer haben ihre
Krawatten abgelegt, ihre Jacketts über die Stühle gehängt.
Die blonde osteuropäische Kellnerin bringt eine Flasche
Bordeaux nach der anderen, jede kostet 245 Euro. Amerikaner
mit sehr weiss
en Zähnen trinken mit gut gelaunten Indern und
smarten Chinesen. An ihren Tischen sitzen Frauen, die sich
ein paar Monatsgehälter an die Ohrläppchen gehängt haben.
Vor der gross
en Restaurantscheibe stehen ein Porsche 4S
und ein getunter schwarzer M-Klasse-Mercedes, dessen
Chauffeur auf einem kleinen Monitor im Armaturenbrett laut
kantonesisches Fernsehen schaut, während er auf seinen Chef
wartet.
Die Banker, die hier zu Abend essen, arbeiten tagsüber in
einem der gigantischen Türme wie dem World Financial Center,
von wo man bei schönem Wetter bis zum chinesischen Festland
sehen kann. Jetzt, zum Ausklang der Woche, gönnen sie sich
ein japanisches Wagyu-Steak, eines der exklusivsten
Vergnügen in Hongkong. Wagyu bedeutet »japanisches Vieh«.
Den Schwarzrindern, besonders denen aus der Region um Kobe,
sagt man nach, sie lieferten das beste Fleisch der Welt. Bei
einer Auktion in Japan ging ein zartes Kilo davon für
umgerechnet 43.000 Euro über den Tisch.
Es war in den frühen Tagen dieser Krise viel von der Gier
die Rede, vom monetären Rausch mancher Bankmanager, die
während ihrer Hatz nach der höchsten Rendite jeglichen Sinn
für das Risiko verloren hatten. Es hiess, dass bessere
Kontrollen und andere Gesetze die Finanzmärkte ernüchtern
und ihnen das rationale Denken zurückgeben könnten. Nichts
an dieser Analyse ist falsch, und doch übersieht sie ein
tiefer liegendes Problem, das viele Wirtschaftswissenschaftler
längst für die eigentliche Ursache der Weltrezession halten.
Im Restaurant Wagyu in Hongkong tritt dieses Problem
zutage. Es liegt nicht darin, dass die Banker an einem Abend
mehr Geld ausgeben, als manche Menschen in ihrem Leben
verdienen. Es liegt darin, dass sich dadurch ihr Konto nicht
leert. Dass sie nicht mehr wissen, wohin mit den Millionen.
Es liegt vor allem darin, dass es auf der Welt inzwischen
sehr viele Leute gibt, denen es so geht.
Egal, ob in Amerika, Europa oder dem Fernen Osten:
Überall ist in den vergangenen Jahren die Zahl derer
gestiegen, die neben all ihren Immobilien und Autos ein
Geldvermögen besitzen, das nicht drei, vier, fünf oder zehn
Millionen beträgt, sondern dreissig Millionen, hundert
Millionen oder gleich eine Milliarde.
Aus dem jährlich erscheinenden World Wealth
Report, gemeinsam erstellt von der
Unternehmensberatung Cap Gemini und der
Investmentbank Merrill Lynch, geht hervor: Die Zahl
der sogenannten Ultra High Net Worth Individuals hat
sich zwischen 1997 und 2007 mehr als verdoppelt. Das
sind Menschen, die ein Finanzvermögen von mehr als
30 Millionen Dollar haben. Der Börsencrash vom
vergangenen Herbst 2008 hat ihren Wohlstand
vorübergehend geschmälert. Jetzt steigt er wieder.
Die massenhafte Existenz dieses neuen ökonomischen Typs
des Superreichen wäre nicht weiter schlimm, solange die
Billionen ausgegeben würden, für Autos, Häuser, Schmuck, was
auch immer. Dadurch würden neue Arbeitsplätze entstehen. In
der Praxis aber ist nach dem zehnten Haus, dem zwanzigsten
Auto meistens Schluss.
Die Zahl der Superreichen hat sich
zwischen 1997 und 2007 verdoppelt
Der vermögende New Yorker Börsenhändler Raymond »Vox«
Carbone zum Beispiel will demnächst teuren Wein aus Italien
an sich selbst und seine Freunde liefern. Es ist eine
Spielerei, mehr nicht, ansonsten besitzt er ja schon alles.
Eine riesige Gitarrensammlung, ein Haus auf Long Island,
eines in Sizilien, eine Wohnung in Manhattan, eine in
London. Und eine Dauerkarte für seinen Lieblingsfussballklub
Arsenal London. Wenn er es schafft, fliegt er zu den
Spielen. Meist schafft er es nicht.
Carbones restliche Millionen liegen auf Konten,
verwandeln sich in Aktien, Anleihen oder sonstige
Wertpapiere und Spekulationsobjekte, sie pusten die
Blasen an den Börsen weiter auf. Für dieses Geld gilt das,
was Wirtschaftswissenschaftler mit einem etwas
blutleeren, aber treffenden Wort beschreiben: Es wird nicht
konsumwirksam.
Nun ist es aber so, dass der Kapitalismus nichts so sehr
braucht wie den Konsum. Irgendjemand muss all die Autos,
Kühlschränke, Flachbildschirme, Fotoapparate und
Plastikpuppen, die jeden Tag auf der Welt produziert werden,
kaufen. Nur wer?
Den Durchschnittsbürgern fehlt das Geld. Das
Einkommen des Stahlarbeiters aus dem amerikanischen
Bundesstaat Ohio, des Lehrers aus der japanischen
Millionenstadt Osaka, der Verkäuferin aus Ludwigshafen am
Rhein steigt seit Jahren kaum noch. Ein Trend, der nach
Angaben der Industrieländerorganisation OECD für fast
alle hoch entwickelten Volkswirtschaften gilt. Auch das ist
ein Grund, weshalb die MTK-Giesserei im unterfränkischen
Kitzingen keinen Kredit mehr bekam. Die Autokonzerne werden
ihre Autos nicht mehr los.
In Amerika schien man das Problem elegant gelöst zu
haben, indem man nicht nur Schlossern und Lehrern, sondern
auch noch Putzfrauen und Erntehelfern hohe Kredite gab. Weil
sie nicht genug Geld verdienten, liehen sie sich welches, um
sich Autos und Häuser zu kaufen. Bis klar wurde, dass sie
ihre Kredite nie würden zurückzahlen können. Bis die Blase
platzte und die gross
e Krise begann.
Der Kapitalismus braucht nichts so
sehr wie den Konsum
Seitdem ist da plötzlich überall auf der Welt jemand, der
viel Geld ausgeben muss, um Autos zu finanzieren,
Bauunternehmen zu Aufträgen zu verhelfen, den Mittelstand zu
unterstützen, kurz: den Konsum und damit den Kapitalismus zu
stärken. Es ist der Staat.
Die Konjunkturprogramme der amerikanischen, der
deutschen, der englischen, der japanischen Regierung haben
Unternehmen saniert, Jobs gerettet und wahrscheinlich die
Weltwirtschaft vor dem Zusammenbruch bewahrt. Aber sie haben
auch dazu geführt, dass dem Staat nun an anderer Stelle das
Geld fehlt.
Neben der weltweiten Kluft zwischen Oben und Unten hat
sich ein weiterer Spalt aufgetan: zwischen privatem Reichtum
und öffentlicher Armut.
Es gibt in Deutschland viele Orte, an denen man die
Vorzeichen dieser neuen Armut besichtigen kann. Die
Schwimmbäder der Stadt Bochum zum Beispiel, in denen das
Wasser jetzt ein Grad kühler ist als früher. Oder eine
Berufsschule in Kiel, wo der Hausmeister die Fenster
zugenagelt hat, damit sie nicht aus dem Rahmen fallen. Oder
das Theater in Wuppertal, in dem demnächst die Türen
zugenagelt werden, weil die Stadt es wohl schließen muss.
Nichts davon wäre anders, hätten die Zentralbanken darauf
verzichtet, den Privatbanken billiges Geld zu leihen. Im
Gegenteil, viele Finanzhäuser wären zusammengebrochen und
hätten Konzerne und Kleinbetriebe mit sich gerissen. Und
doch hat es etwas Ernüchterndes, zu sehen, dass der Grossteil
des Zentralbankgeldes in den Händen der Banker und
Finanzmanager verblieben ist. Dass es sich kaum in neue
Produkte, Löhne, Arbeitsplätze und Steuergelder verwandelt
hat.
Am bedrückendsten ist wohl eine nackte Zahl. Grellrot
leuchtet sie vom Eingang des Hauses Französische Strasse Nr.
9 in Berlin herunter, wo der Bund der Steuerzahler seinen
Sitz hat. Die Zahl beträgt 1,6594 Billionen, ungefähr
jedenfalls. Genau kann man es nicht sagen, weil sie ständig
steigt. Von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag, von Woche zu
Woche, von Monat zu Monat.
1,6594 Billionen Euro, das sind die Schulden der
Bundesrepublik Deutschland Anfang des Jahres 2010. 1,6594
Billionen Euro, das bedeutet: viel Arbeit für Carl-Heinz
Daube.
Daube, groß, hager, knapp 50 Jahre alt, hat einen
ähnlichen Beruf wie jener Herr S., der für eine gross
e
deutsche Bank arbeitet und ganz am Anfang dieser Geschichte
stand. Auch Daube ist ein Geldbeschaffer. Nur dass es der
deutsche Staat ist, für den er die Milliarden auftreiben
soll.
Die Firma, die Daube leitet, heisst Bundesrepublik
Deutschland Finanzagentur. Sie hat 330 Mitarbeiter. Sie
gehört dem deutschen Staat und hat nur eine Aufgabe: im
Auftrag Deutschlands Kredit aufzunehmen.
An den Wänden hängen Schatzbriefe aus Zeiten, in denen
man noch in Tausenden rechnete. Eine »Schuldverschreibung
der Stadt Duisburg über Eintausend Mark« ist dabei. Sie
stammt aus dem Jahr 1921.
© Quelle: Statistisches
Bundesamt/Grafik: ZEIT ONLINE
Auch die Verschuldung pro Kopf stieg
von 1950-2008 steil an
Heute geht es um Milliarden. Das Prinzip aber ist
dasselbe geblieben. Der deutsche Staat besorgt sich Geld,
indem er eine sogenannte Staatsanleihe verkauft, ein Papier,
auf dem steht, wann er das Geld zurückerstattet und wie
viele Zinsen er dafür zahlt. Wenn viele Banken, viele
Investoren diese Papiere haben wollen, hat Carl-Heinz Daube
gute Arbeit geleistet.
So wie am 11. November 2009. Da stehen die wichtigsten
Mitarbeiter der Finanzagentur im Handelsraum und schauen auf
die Computerschirme. Der Bund legt neue Papiere auf, er
braucht mal wieder Geld. Sechs Milliarden Euro will sich der
Staat allein an diesem Tag leihen.
Man kann in diesem Moment nicht beobachten, wer all die
Staatsschulden bezahlen muss, in zehn Jahren, wenn die
Papiere fällig werden. Die Alten? Die Jungen? Die Armen? Die
Reichen? Niemand weiss
das. Aber man kann an diesem 11.
November beobachten, wer an den Schulden verdienen wird. Es
sind die Käufer der Anleihen.
Die Banken verdienen gut an den
Schulden der Bundesrepublik
Ihre Namen erscheinen auf den Bildschirmen in der
Finanzagentur, so wie damals am 24. Juni 2009 im ersten
Stock des Eurotowers, als es für die Banken Daarum ging, sich
Geld von der EZB zu leihen. Es sind fast dieselben Namen:
Die Deutsche Bank ist dabei, die Commerzbank, die
HypoVereinsbank, Goldman Sachs, JP Morgan.
1,5 Billionen Euro haben sich die Privatbanken in
den vergangenen Monaten geliehen, von der
Europäischen Zentralbank in Frankfurt, von der
Federal Reserve in New York, von der Bank von Japan
in Tokyo. Mit einem Teil dieses Geldes kaufen sie
nun die Anleihen der Bundesrepublik. Das Geld
finanziert die Abwrackprämie, die Kurzarbeit, die
Rettung der Wirtschaft. Es hält den Kapitalismus am
Leben.
Jedes Jahr wird der Staat dafür zahlen müssen. Jeden Tag,
jede Woche, jeden Monat werden Zinsen fällig. Dann machen
die Banken ein gutes Geschäft. Sie sind es, die die Zinsen
kassieren. Allein an den Papieren, die Carl-Heinz Daube an
jenem 11. November ausgibt, verdienen sie fast zwei
Milliarden Euro.
Am Ende gewinnt immer die Bank.